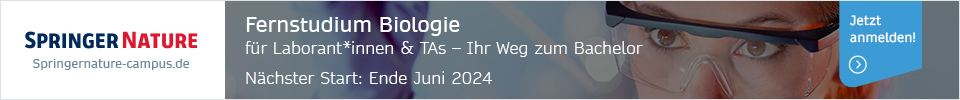Was wissen wir (noch nicht) über SARS-CoV-2?
(26.03.2024) Impfungen, Long-Covid, ME/CFS und verlorenes Vertrauen: Fünf Forschende teilen mit uns ihren Blick auf COVID-19 – vier Jahre nach Beginn der Pandemie.
Zum Erscheinungstag dieser Laborjournal-Ausgabe ist es ziemlich genau vier Jahre her, dass ein neuartiges Coronavirus Anlauf genommen hatte, um eine weltweite Pandemie einzuläuten. Nur wenige Tage zuvor war es auf den Namen „SARS-CoV-2“ getauft worden. Auch im deutschsprachigen Raum war der Erreger bereits angekommen, doch es sollte noch rund einen Monat dauern, bis die ersten Schulen, Kitas, Restaurants und Kinos geschlossen wurden. Die COVID-19-Vakzine von BioNTech und Moderna noch im selben Jahr brachten den Wendepunkt für ein Zurück zur Normalität. Risiken und Nebenwirkungen: Beleidigungen wie „Impfdrängler“ oder „Impfschmarotzer“ fanden ihren Weg bis in die Polit-Talkshows.
Ängste, Polarisierung, Paper
Inzwischen ist die Pandemie offiziell beendet; die Polarisierung gerade in den sozialen Online-Netzwerken aber bleibt: Die einen warnen vor den Impfungen, während andere die STIKO kritisieren, zu zurückhaltend mit ihren Empfehlungen zu sein. Alles nicht dramatisch, sagen die einen – schließlich kann man nicht ewig mit Maske und auf Abstand durchs Leben gehen. Andere warnen, COVID-19 sei nach wie vor keine Erkältung, sondern eine Multisystem-Erkrankung. Jede wiederholte Infektion schwäche den Organismus weiter und hinterlasse irreversible Schäden: nachhaltige Veränderungen im Immunsystem, Schädigungen der Blutgefäße und Nervenzellen – all das auch nach milden Verläufen.
Zu jeder Behauptung findet sich immer irgendein Paper als Beleg, oft Preprints, manchmal aber auch in hochrangigen Fachzeitschriften publiziert. Ein Beispiel von vielen ist ein Twitter/X-Fund, wonach jeder Infizierte auf die eine oder andere Art Long-Covid bekäme – mit Link zu einem Blogbeitrag. Dort wiederum führt ein Verweis zu einer Arbeit in Nature Communications. Deren Autoren um Margarita Dominguez-Villar vom Imperial College London hatten Monozyten von COVID-19-Patienten nach milden Verläufen unter die Lupe genommen und beschreiben eine Umprogrammierung, die zu einer gesteigerten Neigung zur Blutgerinnung führt (Nat Commun. doi.org/jrkp). Das alles könnte doch passen zum erhöhten Thrombose-Risiko nach einer COVID-19-Erkrankung.
Ratlos zwischen Tweets und Papern
Im Blogbeitrag sowie auf Twitter/X werden außerdem Vergleiche zu HIV und AIDS gezogen. Schaut man sich allerdings den Diskussionsteil der Originalpublikation an, so steht dort, dass unklar bleibe, in welchem Umfang diese Veränderungen COVID-19-spezifisch seien: „Da die Stimulation durch andere Viren und bakterielle Produkte zu ähnlichen Immun-Phänotypen führt [...], scheint es wahrscheinlich, dass diese Prozesse auch bei anderen moderaten viralen Atemwegsinfekten auftreten, so wie es für saisonale Infektionen gezeigt wurde.“ Irgendwo im Spektrum von kompletter Verharmlosung bis zum lustvollen Schüren von Ängsten bleibt also selbst der naturwissenschaftlich informierte Medienkonsument etwas ratlos zwischen Tweets und einer Flut an Publikationen zurück. Eine aktuelle Zahl kurz vor Redaktionsschluss: Mehr als 245.000 Originalartikel mit COVID-19-bezogenen Schlagworten im Titel sind in der Web of Science Core Collection gelistet – Preprints nicht mitgerechnet.
Außer Frage steht, dass jene Langzeitfolgen nach SARS-CoV-2-Infektionen vorkommen können, sogar nach milden Verläufen. Andererseits sorgte im September 2023 ein Artikel für Aufsehen, der auf methodische Schwächen vieler Long-Covid-Studien hinweist und die aktuellen Definitionen kritisiert (BMJ Evid Based Med. doi.org/mkbj). Fehldiagnosen und gesellschaftliche Angst könnten die Folge sein. Unumstritten ist auch diese Analyse von Tracy Høeg et al. aus San Francisco nicht, aber die Beispiele zeigen: Differenzierter wissenschaftlicher Diskurs braucht mehr als 250 Zeichen, und das Abstract eines Papers reicht nicht, um dessen Relevanz einordnen zu können.
Daher sind wir nochmal auf Forschende zugegangen, die während der Pandemie wissenschaftlich, beratend oder im Rahmen von Monitoring-Projekten mit SARS-CoV-2 befasst waren. Einige Namen werden Sie vielleicht noch aus unseren „Corona-Gesprächen“ kennen (siehe das Dossier „Unsere Corona-Gespräche“ auf LJ online). Wir wollten wissen, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Was hätte man damals besser machen können, und wo sind Maßnahmen über das Ziel hinausgeschossen? Wie hat sich der Blick auf das Virus verändert, welche Risiken bringt die Infektion auch jetzt noch mit sich? Und: Was ist derzeit noch unklar?
Pandemie war außergewöhnlich
Beginnen wir mit Volker Thiel, Gruppenleiter am Institut für Virologie und Immunologie an der veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Bern: Schon in den 1990er-Jahren publizierte er zu humanen Coronaviren. Während der Pandemie war er in die wissenschaftliche COVID-19-Task-Force der Schweiz eingebunden, um den Bund zu beraten. Inzwischen sei die Pandemie politisch praktisch abgehakt, berichtet uns Thiel: „Ich würde sagen, man bleibt in Teilalarmbereitschaft und versucht, Informationskanäle offenzuhalten. Aber Schnelltests werden leider nicht mehr bezahlt, die Förderungen sind zurückgegangen.“
Die ersten Monate der Pandemie waren geprägt von großer Vorsicht, und es gibt Kritiker, die anmerken, dass man rückblickend auch mit milderen Maßnahmen ausgekommen wäre. Zum Beispiel hätte man gleich auf FFP2-Masken setzen und unter freiem Himmel weniger restriktive Einschränkungen erlassen können. In der Rückschau aber findet Thiel die Entscheidungen von damals nachvollziehbar: „Die Diskussion, die man heute führt, spiegelt nicht immer das wider, was man damals gefühlt hat. Es sind ja reihenweise Menschen gestorben, zum Beispiel in Italien – aber das scheint heute fast vergessen zu sein.“ COVID-19 sei gerade nicht vergleichbar gewesen mit anderen Pandemien. „Es kommt immer wieder mal zu ungewöhnlichen Influenzawellen, aber selbst da gibt es bei neuen Stämmen Teile der Bevölkerung, die schon ähnliche Varianten ‚gesehen‘ haben“, nennt Thiel einen Unterschied zum damals neuartigen Coronavirus. „Viele Leute vergessen, dass das Virus vor allem deshalb so gefährlich war, weil es in der Bevölkerung praktisch keine Immunität gab. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten so nicht erlebt!“
Im Prinzip treffe das zwar auch auf SARS-CoV-1 in den Jahren 2002 und 2003 zu, allerdings sei SARS-CoV-2 darüber hinaus viel leichter von Mensch zu Mensch übertragbar gewesen, weil es sich auch in den oberen Atemwegen repliziert. Biomedizinisch habe man den Erreger von Beginn an relativ gut eingeschätzt und mit den Kontaktbeschränkungen auch sinnvolle Maßnahmen ergriffen, um vulnerable Teile der Gesellschaft zu schützen.
Der Nutzen der Impfungen war im Umfeld einer immunologisch naiven Bevölkerung offensichtlich. Inzwischen halten viele Menschen den Piks aber für überflüssig. Thiel sieht das anders: „Wir sind ja immer noch als Beratungsgremium in der Schweiz tätig, und wenn ich von Klinikern höre, dass in diesem Jahr so gut wie kein Patient im Krankenhaus war, der sich frisch hat impfen lassen, sondern dass bei den hospitalisierten COVID-19-Patienten mindestens ein Jahr seit der letzten Impfung vergangen ist, zeigt sich aus meiner Sicht klar, dass die Impfung noch immer einen Mehrwert hat.“
Milde Verläufe ohne Daten
Für die Impfempfehlungen zählt vor allem, wie viele schwere Verläufe verhindert werden können. Schwer ist eine COVID-19-Erkrankung per Definition erst, wenn eine Einweisung ins Krankenhaus notwendig ist. Wer bloß zwei Wochen zu Hause das Bett hütet, gilt als mild erkrankt. „Da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ob man das jedes Jahr braucht“, gibt Thiel zu bedenken. Genau diese „verlorenen Tage“ im Jahr, die zudem belastend sein können, fließen aber nicht oder nur zweitrangig in die Impfabwägungen ein. „Die Fälle der Leute, die nicht arbeitsfähig zu Hause sind, werden heutzutage ja gar nicht mehr erfasst“, bedauert Thiel. „Diese Daten bräuchte man aber, um solch eine Risikoabwägung sauber durchführen zu können.“
Doch welche Langzeitfolgen hat eine SARS-CoV-2-Infektion über die akute Phase hinaus? Thiel hat hierzu an Studien mitgewirkt und unter der Federführung französischer Kollegen zum Beispiel am Hamstermodell herausgearbeitet, dass Geruchsverlust und Neuroinvasion wohl voneinander unabhängige Phänomene sind (Nat Commun. doi.org/mkbk). Natürlich lassen sich solche Ergebnisse aus der Grundlagenforschung nicht direkt auf die Epidemiologie in der menschlichen Bevölkerung übertragen. Thiels Resümee zu den Erkenntnissen rund um Long-Covid fällt daher zurückhaltend aus: „Es wird einige Jahre dauern, bis man da durchblickt.“
Verlorenes Vertrauen
Besorgt zeigt sich Thiel über den Diskurs mit der Bevölkerung. Menschen hätten Schwierigkeiten, korrekte Informationen von Fake News zu unterscheiden. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir bei einer weiteren Pandemie einen ähnlichen Zusammenhalt haben wie beim ersten Lockdown. Wir müssen aufarbeiten, wie es zu dieser gesellschaftlichen Polarisierung kommen konnte, und wie wir die Glaubwürdigkeit wiederherstellen können.“
Unglücklich äußert sich Thiel auch darüber, dass derzeit kaum Daten zu SARS-CoV-2-Infektionen erfasst werden. „Das ist momentan ja fast zum Erliegen gekommen. Aktuell sind wir im Blindflug, und ich befürchte, dass wir Schwierigkeiten hätten, eine neue gefährliche Variante früh zu entdecken.“
Neben Volker Thiel haben wir mit Ulrich Elling über Virusvarianten, mit Carsten Watzl über Immunität, mit Carmen Scheibenbogen über Long-Covid und mit Saskia Trump über COVID-19 bei Kindern gesprochen. Den ganzen Artikel können Sie hier nachlesen.
Mario Rembold
Bild: Playground.com
Dieser Artikel erschien zuerst in Laborjournal 3/2024.
Weitere Artikel aus dem aktuellen Laborjournal-Heft
- Alte Sünden & lange Schatten
Ende 2023 häufen sich die Hinweise, bei den Publikationen von Simone Fulda sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Noch Anfang Februar 2024 bestreitet die Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel alle Vorwürfe. Doch schon am 10. Februar 2024 tritt sie von ihrem Amt zurück – ohne jegliche Untersuchung. Ist das ein Zeichen von Integrität? Oder von Schuld? Sind die Vorwürfe berechtigt? Trägt sie die alleinige Verantwortung?
- Wundversorgung im Reich der Ameisen
Afrikanische Matabele-Ameisen pflegen verletzte Artgenossen nicht nur gesund, sondern stellen dazu notwendige Antibiotika auch selbst in ihren Nestern her. Was lässt sich von ihnen lernen?
- Mehr als nur eine günstige Alternative
Die Idee, Apparaturen für Experimente selbst herzustellen, ist so alt wie die Wissenschaft. 3D-Drucker, frei zugängliche Software, Mini Computer und präzise Bauanleitungen haben ihr aber neues Leben eingehaucht. Noch nie war es für Forschende so einfach, einen großen Teil ihres Laborequipments in Eigenregie zu fertigen.