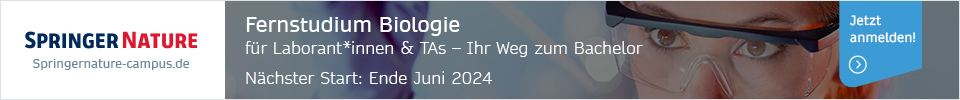Ein "Basta!"-Argument
Der Advocatus DEI kennt freilich keinen Zweifel. Er ist dogmatisch, apodiktisch, vom sakrosankten Charakter seines Anliegens ganz durchdrungen. Er nennt es „normativ“. Wir zitieren aus seinem Text:
„Die Erhöhung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion hat in allen Bereichen der Gesellschaft normativen Charakter […] Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Teil der Sustainable Development Goals der UN sowie der Open Science Standards der UNESCO […] DEI in der Wissenschaft muss sich daher nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob wir sie wirklich brauchen – sondern damit […], wie wir sie am effektivsten gestalten […].“
Das ist schon so eine Art von „Basta!“-Argument, oder, um im Theologischen zu bleiben, ein „Deus lo vult!“, ein „Gott will es!“ – und ab in den Kreuzzug.
Als Advocatus Diaboli fragt man sich freilich, inwiefern es Sache der UN und der UNESCO ist, der Wissenschaft ihre Regeln zu setzen. Gleichzeitig nimmt man zur Kenntnis, dass man hier in einen normativen Prozess geraten ist – mithin in einen Vorgang, in dem es um Sollen und Wollen geht, und damit, so schließt man diabolisch messerscharf, in einen Prozess, in dem nicht sein soll, was nicht sein darf, oder, andersherum, in dem alles werde, wie man es gerne hätte. Normativ eben.
Politisch korrekte Volte
Der Teufel würde vermutlich einwenden, dass es doch eigentlich das Faktische sein sollte, das der Wissenschaft die Normen setzt; wahrscheinlich würde er mit David Hume, dem alten Skeptiker, darauf verweisen, dass normative und empirische Urteile zwei sehr verschiedene Dinge sind.
Womit wir im Reich der Empirie wären und fragen können, wie es dort denn um DEI steht. Rein Gender/Diversity-mäßig: Schlecht! Nur etwa jedes hunderttausendste Neugeborene lässt sich, nach Daten des Statistischen Bundesamtes von 2022, aufgrund der Ausprägung seiner körperlichen Merkmale nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Sexus zuordnen. Trotzdem – trotzig fast – betitelt in der nämlichen Ausgabe des Laborjournals Herr Professor Tautz, ein Evolutionsbiologe, seinen Aufsatz, mit dem er Dirnagls Plädoyer für DEI assistiert, mit der Überschrift „Die Illusion der Binarität“. In dem er allerdings wieder und wieder konzedieren muss, dass es, zumindest beim Menschen und den meisten Eukaryonten, eben doch nur zwei Geschlechter gibt – mit einer, so schreibt er, „zwar sehr schmalen, aber doch existierenden Überlappung (die aber heutzutage meist chirurgisch korrigiert wird.)“ In der Tat: Einer in hunderttausend ist eine sehr schmale Überlappung – und ist, trotz Tautzens kernigem „aber doch“, sicher nicht hinreichend, um die Binarität des biologischen Sexus zur „Illusion“ zu erklären. Im letzten Absatz schlägt dann Professor Tautz die politisch korrekte, „woke“, normative, von keiner empirischen Evidenz gestützte Volte – und schlägt vor, die Geschlechts- und Genderkategorien allesamt ganz abzuschaffen. Selbst das „d“ für „divers“ hält er für kontraproduktiv, denn es sei ja auch eine Kategorie: Keiner solle sich zu irgendeinem Geschlecht oder Gender bekennen müssen, denn „bei einer verfassungsrechtlich gesicherten Gleichstellung der Geschlechter muss der Staat ja gar nicht mehr wissen, welchem Geschlecht sich jemand zugehörig fühlt.“
Der Teufel hat viele Leben
Da lacht der Advocatus Diaboli, denn wenn keiner mehr weiß, ob Männlein, Weiblein, intersektional queer, hermaphroditisch oder gänzlich asexuell, ob migrantisch oder autochthon, hell oder dunkel, dann hat sich’s ja auch mit der Beförderung der dahingehenden Diversität in der Wissenschaft erledigt, weil man sie nicht mehr erkennt. Und man müsste ja glatt auf die Meriten und die Fähigkeit der Person, und nicht auf die Kategorie, in die man sie sortiert, schauen – was übrigens der Advocatus Diaboli in seiner Gegenrede gegen DEI schon immer angemahnt hat.
Zurück zur Herrn Professor Dirnagl, der, auch als „Wissenschaftsnarr“, ein rechtschaffender, wissenschaftlich sozialisierter Schreiber ist: Er legt nämlich, zumindest in der Online-Version seines Editorials über DEI, eine detaillierte Liste von etwa 70 Publikationen bei, um seine Aussagen zu den wissenschaftlichen Wohltaten von DEI zu untermauern und zu belegen. Und er findet, in seinem Plädoyer wider uns – Pfeilschifter und Wicht – die wir die Existenz solcher Evidenzen bestritten haben, die süffige, sprachlich sehr gelungene Formulierung: „Diese Aussagen [von Pfeilschifter und Wicht] zeugen allerdings weniger von der Abwesenheit von Evidenz zum Einfluss von Diversität auf Forschungsqualität und Innovation, sondern sind viel mehr Evidenz für die Abwesenheit von Kenntnis der hierzu existierenden Studienlage.“ Chapeau! Welch ein eleganter, mit lauter negierenden Finten versehener Satz, wie der Stich des tänzelnden Toreros mitten ins Herz des tumben Rindviehs. Zack, da liegen die beiden Ochsen, tosender Applaus von den Rängen in der „woken“ Arena.
Der geneigte Leser sei von den sterbenden Ochsen dennoch gebeten, doch bitte das folgende Kleingedruckte zur Kenntnis zu nehmen, denn der Teufel hat viele Leben, vor allem im Detail ...
----------------------------
Wenn man sich auf Professor Dirnagls Liste einlässt, wird man recht rasch bemerken, dass die meisten der aufgeführten Publikationen rein normativen Charakters sind – es geht dort darum, wie DEI zu bewerkstelligen sei, selten darum, was sich tatsächlich empirisch zu den Vor- und Nachteilen der Diversifikation des wissenschaftlichen Personals herausfinden lässt. Denn die Hypothese ist ja, dass diversifizierte Teams bessere Wissenschaft produzieren als homogene. Aber doch, einige Publikationen dazu gibt es – allerdings sind sie so beschaffen, dass sie selbst den Teufel, der in ihren Details nistet, in Zweifel und Verzweiflung treiben können.
Erstens: Wie misst man eigentlich die „Güte“ von Wissenschaft? Klar: über Impact-Faktoren und Zitationsindizes der Publikationen, die die Wissenschaftler produzieren. Es gibt ein ganzes Forschungsgebiet, die Bibliometrie eben, die sich mit derlei beschäftigt. Kennen Sie die weltweit meistzitierte Publikation? Hier ist sie:
Lowry O.H. et al., Protein Measurement With The Folin Phenol Reagent, J. Biol. Chem. (1951) 193(1): 265-75.
Etwa 300.000 Zitate hat dieses Paper auf sich gezogen (Nature 514: S. 550 ff.). Auch die folgenden Publikationen unter den „Top Ten“ stammen alle aus der (bio-)chemischen Labor-Methodologie, die offenbar die beste Wissenschaft der Welt ist. Es lebe das Labor! Und natürlich sein Journal!
Einstein ist nicht unter den Top 100, Darwin nicht, noch nicht mal Watson und Crick haben es dorthin geschafft. Mit anderen Worten: Die wirklich bahnbrechenden Ideen verbreiten sich außerhalb der Publikationen, in denen sie ursprünglich vorgestellt wurden – weswegen der ganze bibliometrische Ansatz über Impact und Zitate schon im Kern ziemlich fragwürdig ist.
Aber egal, wir haben ja nichts anderes – vor allem dann nicht, wenn man, fein säuberlich korrelierend, die Impactschwere und Zitationshäufigkeit eines Papers mit der Zusammensetzung des Teams, das es produzierte, in Zusammenhang bringen will. Und das will man ja durchaus! Dumm ist jetzt nur, dass man bei der computerbasierten, algorithmischen Durchforstung von Millionen von Publikationen deren Autoren, von denen man meist nur den Namen hat, fein säuberlich nach Sexus, Genus, Gender, Ethnie, Rasse, Alter, Migrations- und Bodenständigkeitshintergründen et cetera sortieren muss. Kurz, man arbeitet detailliert an der Perpetuierung der kategorialen Schubladisierung der Menschheit, die man doch eigentlich überwinden wollte. (Wir meinen die Schubladisierung, nicht die Menschheit – deren Überwindung ist ein anderes Projekt).
Das ist wirklich zum Verzweifeln, und zugleich eben auch das Kernproblem des ganzen identitären „Wokeismus“: Er zementiert die Verschiedenheit, die er doch zugleich im Sinne der Gleichheit überwinden will. Es ist zum Haareraufen hirnrissig: Da wird, in manchen dieser bibliometrischen Publikationen, die (forschende) Menschheit nach Altväter Sitte in „Rassen“ eingeteilt (siehe etwa B. Shameer et al.: Relationship between diversity of collaborative group members’ race and ethnicity [...], Empir. Software Eng. 28 (4), 83) – aber wir dachten doch, dass „Rasse“ eigentlich ein kolonialistisch-repressives Konzept sei, dem keine biologische Realität zukomme. Überall werden die Autoren munter nach binärem Sexus (w/m) sortiert, von dem es aber doch gerade noch hieß, dass er ein ebenso repressives, heteronormatives Konzept sei, das überwunden werden müsse.
Zwei solcher Publikationen in hochangesehenen Journalen sind es, die von den Advocati DEI gerne triumphierend zitiert werden – nämlich: AlShebli et al.: The preeminence of ethnic diversity in scientific collaboration, Nat. Commun. 9: 5361 sowie Yang et al.: Gender-diverse teams produce more novel and higher-impact scientific ideas, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 119 (36): e2200841119. Und zwar nach dem Motto: „Da ist sie doch, die empirisch-bibliometrische Evidenz für den Segen der Diversität!“ Es sind zwei „Brute-Force“-Publikationen, die auf der automatisierten Durchforstung von Millionen von englischsprachigen Publikationen und deren Zitations- und Autorenlisten basieren. Es ist allerdings beschämend, dass die (notwendige) Kritik an der Logik und Methodik dieser beiden Publikationen sich nicht in deren Peer-Reviews, sondern in einem Aufsatz von Wolfgang Krischke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung findet (Krischke: Vom Nutzen und Nachteil der Vielfalt, FAZ vom 4.5.2023). Er moniert – völlig zu Recht – die zahlreichen Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten der automatisierten, algorithmischen Klassifikation der Autoren. Wir hätten im Folgenden allerdings noch nachzutragen, dass die in diesen Publikationen präsentierten Daten deren überaus schmackhafte, geradezu reißerischen Titel in keiner Weise rechtfertigen
So präsentieren AlShebli et al. im „Hochglanzteil“ in Abbildung 3 ihrer Publikation eine wirklich deutliche Korrelation (r = 0,77) zwischen „ethnischer Diversität der Autoren“ und „Zitationshäufigkeit“, die allerdings – versteckt im „Supplementary Material“, Abbildung 8 und Tabelle 2 – auf r-Werte um 0,05 zusammenschnurrt. Was daran liegt, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Denn die knallige Korrelation ergibt sich, wenn man die mittlere ethnische Diversität der Autoren eines ganzen Faches (von Theaterwissenschaften bis zu Ingenieurswissenschaften) zu der Zitationshäufigkeit der Publikationen in ebendiesem Fach in Beziehung setzt. Guckt man jetzt in die Einzelfächer, schmelzen, wie gesagt, die Korrelationen bis zur Nichtigkeit zusammen – ärger noch, manch positive Korrelation, die man gerne hätte (nämlich beispielsweise die zwischen geschlechtlicher Diversität der Autorenteams und der Zitationshäufigkeit), wird sogar negativ.
Anders gesprochen: Innerhalb eines Faches ist die Diversität eines Autorenteams – sei sie ethnisch oder geschlechtlich – ein ganz lausiger Prädiktor für die Zitationshäufigkeit der Publikation des Teams. Es sei daran erinnert, dass bei einem „r“ von 0,05, selbst wenn es auf einem kausalen Zusammenhang zwischen „Diversität“ und „Erfolg“ beruhen sollte (was die Korrelation natürlich nicht beweisen kann), man gerade mal zwei Promille der „ursächlichen Kräfte“ erfasst, die zwischen den Variablen wirken mögen. Mit anderen Worten 99,8 Prozent der wechselnden „Erfolge“ von Fachpublikation lassen sich nicht mit der „Diversität“ erklären. Oder nochmal anders: Die Magnitude des Effekts ist minimal bis nichtig (siehe: Cohen, Statistical power analysis for the behavioral sciences, Academic Press, 1988) – da helfen auch die allertollsten p-Werte nicht.
Und dass die Diversität zwischen den Disziplinen ein guter Prädiktor ist, ist zwar interessant, aber nicht leicht zu verstehen. Womöglich hat es ja mit der schieren Größe und Thematik der Fächer zu tun: Die Ingenieurs- sowie Bio- und Lebenswissenschaften (die sich als sehr divers und zugleich zitationshäufig zeigten) ziehen sicher von vorneherein eine andere, größere, diversere, einander fleißiger zitierende Forscherklientel an als die englischsprachigen Theaterwissenschaften, um deren mittleren Diversifikationsgrad sowie Zitationshäufigkeit es AlShebli et al. zufolge im Vergleich zu den übrigen Fächern ganz schlecht steht. Aber auch diesen, das zeigt wieder die innerfachliche Analyse, ist durch die ethnische Diversifikation ihres Personals nicht aufzuhelfen. Was im Übrigen auch für die rein geschlechtliche Diversifikation des Forscherpersonals gilt. Hier scheuen sich Yang et al. nicht, einen ebenso schäbigen Korrelationskoeffizienten von etwa 0,05 (innerhalb der Medizin) zu einem „Gender-diverse teams produce more novel and higher-impact scientific ideas“ aufzublasen. Und – so sei noch angemerkt – PNAS schreckt auch nicht davor zurück, solche statistischen Windeier zu publizieren.
----------------------------
Sofern der geneigte, geduldige Leser sich durch die obige pandorisch-diabolische Box gequält haben sollte, versteht er vielleicht, weswegen die beiden toten Ochsen jetzt wieder auferstehen und – in der Rolle der zweifelnd/verzweifelten Advokaten – fragen, ob denn der Herr Professor Dirnagl von den Publikationen mehr als die Überschriften und die Abstracts zu Kenntnis genommen hat. Empirische Evidenzen liefern die Veröffentlichungen jedenfalls nicht.
Divers macht's nicht schlechter
Als Advocatus Diaboli bleibt einem am Ende allerdings wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als resignierend zu konzedieren, dass, wer an der Seite von DEI streitet, eben ihn, Deus, an seiner Seite hat. Und wenn der Gott des normativen Zeitgeistes mit ihm ist – wer könnte da gegen ihn sein? Ein r-Wert? Die Abwesenheit empirischer Evidenz? Petitessen. Primat des Sollens über das Sein! Jawohl!
Auf der erfreulichen Seite immerhin: Die Wissenschaft wird ja dadurch, dass sie diverser wird, auch nicht schlechter – denn so kann man das, was oben in der Box steht, ja auch interpretieren. Sie hält offenbar einiges aus, die Wissenschaft, und funktioniert mit lauter alten, weißen Männern ebenso gut oder schlecht wie mit diversifizierten Teams. Nur die Behauptung von Evidenzen, wo keine sind, die bekommt ihr schlecht. Hingegen taugt das, was aus Professor Tautzens Vorschlag (siehe oben) folgt, als normative Maxime sehr gut: Nicht wer was sagt, sondern was wer sagt, sollte, zumindest in den Naturwissenschaften, die Maßstäbe setzen. Nieder mit der Diktatur der Identitäten!
Josef Pfeilschifter ist Direktor des Instituts für Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Helmut Wicht ist einer seiner langjährigen Mitarbeiter..
(Illustr.: Faust und Mephisto, Autor unbekannt)
Weitere Artikel zu "Wokeness in der Wissenschaft"
>> Woke Wissenschaft: Bremse oder Beschleuniger von Qualität und Innovation?
Warum hinkt Deutschland bei der Erhöhung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) in der Wissenschaft derart hinterher? Dabei ist doch längst gezeigt, dass Forschung davon profitiert ...
>> Biologisches Geschlecht – Die Illusion der Binarität
Männlich, weiblich, divers oder anders – die Gesellschaft tut sich schwer in der Geschlechterdiskussion. Dabei gehört Geschlecht überhaupt nicht in Kategorien gepresst, wenn man die biologische Geschlechtsentwicklung als Gesamtprozess zugrunde legt ...
>> Streit um Hitler-Käfer und Trump-Motte
Viele Taxa sind nach Eigennamen benannt. Dabei reflektiert die Namenswahl eine Zeit, in der hauptsächlich weiße, reiche Männer Wissenschaft betrieben. Manch ein Namenspate kann heute nicht mehr als Vorbild gelten. Ob betroffene Taxa umbenannt werden sollen, darüber streiten sich Taxonomen ...
Letzte Änderungen: 20.03.2024