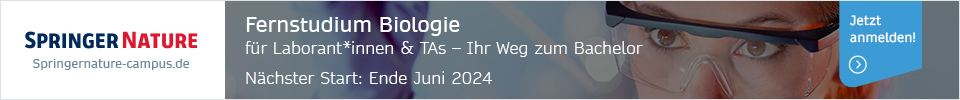Keulenschlag von Amöben
Das womöglich bekannteste Paradoxon in der Biologie dürfte indes das C-Wert-Paradoxon sein. Das C steht hierbei für Chromatin, und der entsprechende Wert gibt an, welche Gesamtmenge an DNA der einfache Chromosomensatz eines Organismus enthält. Der C-Wert für uns Menschen beträgt demnach 3,2 Gigabasen. Was zum Beispiel Lilien mit ihren knapp 40 Gigabasen locker toppen. Oder auch diverse Amphibien mit über 80 Gigabasen. Doch auch diese müssen sich weit hinter dem Lungenfisch Protopterus aethiopicus mit seinen über 130 Gigabasen anstellen. Und den sehen einige Forscher immerhin als den nächsten lebenden Verwandten derjenigen Wirbeltiere an, die erstmals aus Wasser heraus das Festland besiedelten. Auf der evolutionären Linie von ihnen zu uns Menschen könnte also ganz schön viel Genom verloren gegangen sein.
Den größten Keulenschlag hielt das „das Unerwartete“ jedoch mit Amöben bereit: Für Amoeba proteus und Amoeba dubia wurden C-Werte von 290 und 670 Gigabasen ermittelt. Die formvariablen Einzeller haben demnach bis zu 210-mal mehr DNA in ihren Genomen als wir.
Einzeller mit mehr Genen als der Mensch
Doch worin genau besteht das Unerwartete, das Paradox? Oder anders herum gefragt: Was hatte man denn erwartet? Es schien einfach klar: Wir Menschen sind komplexer als Lilie oder vor allem Amöbe – und das geht nur mit mehr Information im genetischen Bauplan. Folglich, so schloss man seinerzeit, müssen wir auch mehr DNA im Genom haben.
Das Schöne an wissenschaftlichen Paradoxa ist jedoch, dass sie oftmals auf tiefer verborgene Wahrheiten hindeuten. Und so wissen wir heute, dass die großen C-Wert-Unterschiede vor allem durch bisweilen enorme Ausweitungen von DNA-Abschnitten zustande kommen, die im Genom weder irgendetwas codieren noch regulieren. Grob vereinfacht also: Wer viel DNA hat, hat meist auch viel „Schrott“ im Genom.
Doch mit dem Genom-Paradoxon war damit noch lange nicht Schluss. Denn auch wenn wir Menschen weit weg von einem Gigabasen-Spitzenplatz sind, lebte die Erwartung erstmal weiter, dass sich in unseren Genomen trotzdem am meisten Information tummelt – sprich: die größte Zahl an Genen. Doch auch hier förderte das Humangenomprojekt wieder Unerwartetes zutage, als es gerade mal rund 21.000 Protein-codierende Gene zählte. Erwartet waren über 100.000. Und erneut zeigte sich: Eine ganze Reihe von Organismen hat deutlich mehr, darunter auch wieder einige Einzeller wie etwa Paramecium tetraurelia (knapp 40.000) oder Trichomonas vaginalis (fast 60.000).
Gene raus aus dem Genom
Auch dieses Paradoxon öffnete die Tür zu bislang verborgenen Erkenntnissen. Dass wir dennoch deutlich komplexer daherkommen als Organismen mit üppigerer Ausstattung an Protein-codierenden Genen, verdanken wir der Tatsache, dass wir absolute Weltmeister in der multiplen Nutzung und Kombinatorik unserer Gene sind – was zusammengenommen ein einzigartig flexibles Wirken von vielfältigen und komplexen genetischen Netzwerken ermöglicht.
Einfach nur viele Gene zu haben, ist also ganz offensichtlich nicht das Nonplusultra, um komplexes Leben zu entwickeln. Dem steht übrigens auch ein anderer Trend in der Evolution entgegen: Gene schnellstmöglich aus dem Genom zu schmeißen, wenn man sie nicht mehr braucht. Beispiele dafür gibt es viele: Organismen, die von der freien zur parasitären Lebensweise wechseln und ruckzuck jede Menge Gene für von da ab nicht mehr benötigte Stoffwechselwege eliminieren; Fische, die in dunkle Höhlen umziehen und zügig die Gene für die Augenbildung verlieren; oder Fadenwürmer, deren Vorfahren auf Zwittertum und Selbstbefruchtung umstiegen und die heute tausende Gene weniger haben als ihre zweigeschlechtlichen Wurm-Verwandten. Gene zu unterhalten scheint die Zellen also einen hohen Energiepreis zu kosten – sodass offenbar stets für jeden Einzelfall kalkuliert wird, ob sich der Stoffwechsel-Aufwand tatsächlich lohnt. Und falls nicht: Ex und hopp!
Das Angiospermen-Paradoxon
Nach Genomanalysen von US-Biologen soll sogar der grandiose Siegeszug der bedecktsamigen Pflanzen (Angiospermen) insbesondere auf solch einer radikalen Genomverkleinerung beruhen (PLoS Biol. 16(1): e2003706). Und damit wären wir erneut beim Thema, denn das klingt erstmal paradox. Schließlich war das Auftauchen der ersten Angiospermen vor etwa 100 Millionen Jahren dadurch geprägt, dass ihre Pflanzen-Vorfahren zuvor in mehreren Linien ihr komplettes Genom dupliziert hatten. Diese enorme Masse an Extra-Genen versetzte sie plötzlich in der Lage, schnell neue Zellfunktionen zu entwickeln und sich ungewöhnlich breit zu diversifizieren.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Der Nachteil war, dass die große Menge an genetischem Material den Pflanzen auch umgehend eine enorme physiologische Last auflud. Umso höher war daher der Druck, ungebrauchte Sequenzen schnellstmöglich wieder zu entfernen. Konnten sie nicht schnell genug eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz vorweisen, waren sie bald wieder weg.
Folgerichtig hatten die ersten etablierten Angiospermen nach den Analysen der US-Forscher auch tatsächlich eher kleine Genome. Das ganze Verdoppeln und Ausmisten muss deshalb vorher und innerhalb evolutionsgeschichtlich ziemlich kurzer Zeit stattgefunden haben. Und dies offenbar mit klarem Vorteil für die besten „Ausmister“.
Paradox, aber wahr
Die Autoren sehen genau darin den entscheidenden Schlüssel für den Erfolg, dass die Angiospermen heute 90 Prozent aller Landpflanzen auf Erden ausmachen. Denn im Gegensatz zu den „Großgenom-Pflanzen“, von denen sie sich abspalteten, konnten sie mit weniger DNA damals auch kleinere Zellen produzieren. Was wiederum die Möglichkeit bot, mehr Zellen in die Blätter zu packen und deutlich effizientere Photosynthese zu betreiben. Spätestens damit waren die Angiospermen klar im Vorteil. Und dies vor allem, weil sie radikal unnütze Gene rausgeschmissen hatten.
Womit auch dieses vermeintliche Paradoxon offenbar den Weg zu einer dahinterliegenden Wahrheit geebnet hat.
Ralf Neumann
(Foto: Univ. Wageningen)
Weitere Artikel zum Thema "Genomevolution":
- Je weniger, desto besser
Parasiten haben im Vergleich zu ihren nächsten freilebenden Verwandten hunderte von Gene stillgelegt oder verloren. Und in gar nicht mal wenigen Fällen haben sie sogar ganze Organsysteme abgeschafft, für die sie einfach keine Verwendung mehr haben ...
- Von großen Heuschrecken- und kleinen Menschen-Genomen
Das größte bisher bekannte Genom eines Insekts steckt in den Zellen der alpinen Heuschrecke Bryodemella tuberculata – auf deutsch: die Gefleckte Schnarrenschrecke. Es ist siebenmal größer als unser humanes ...
- Wertvoller Schrott – Nicht-codierende RNAs im Überblick
RNA-Interferenz ist mehr als nur eine Labormethode. So regulieren etwa kleine nicht-codierende RNAs die Proteinsynthese oder wehren Parasiten ab. Und dann gibt es auch noch längere RNAs, die sogar Chromosomen stilllegen können ...