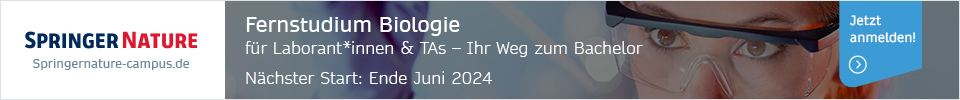Gehört die Ostsee dann auch dazu? Die ist ja nach Nordosten hin praktisch ein Süßgewässer.
Gessner: Aber die Ostsee ist über Kattegat und Skagerrak mit der Nordsee verbunden und gehört dadurch zu den Meeren. Deshalb ist die Ostsee nicht Thema der Limnologie. Das Kaspische Meer hingegen hat keine Verbindung zum Ozean und gehört damit zu den Binnengewässern, ist eigentlich also ein See. Obwohl es Kaspisches ‚Meer’ heißt.
Das bedeutet: Wenn es um die Ökologie von Gewässern geht, überschneiden sich die Forschungsfelder der Meeresbiologen und Limnologen.
Gessner: Absolut. Insofern ist die Ostsee ökologisch gesehen interessant: Bei Schleswig-Holstein findet man eher typische salzliebende Meeresorganismen. Nach Schweden und Russland hoch wird es aber sehr süß, und dann findet man ganz kuriose Sachen. Man kann dort typische Süßwasserbewohner neben typischen Salzwasserorganismen beobachten. Zum Beispiel Flussbarsche, die zusammen mit Dorschen schwimmen.
Kommen wir zurück zu den Binnengewässern. Die sind Thema einer Arbeit, die Sie zusammen mit Kollegen 2010 veröffentlicht hatten. Laut unserer Publikationsanalyse wurde das Paper zwischen 2010 und 2014 mehr als 900-mal zitiert und führt damit die Liste an. In der Arbeit haben Sie Daten zu Seen und Fließgewässern auf der ganzen Welt gesammelt und abgeschätzt, wo die Wasserversorgung für den Menschen gefährdet ist. Außerdem haben Sie die Bedrohung der Biodiversität dieser Gewässer abgeschätzt. An dieser Stelle frage ich jetzt mal ganz böse: Wenn ich mich für die Wasserversorgung der Bevölkerung interessiere, warum muss ich mich dann mit Biodiversität beschäftigen? Es reicht doch, wenn es ausreichend regnet und ich irgendwie genügend frisches Wasser zur Verfügung habe!
Gessner: Da treffen Sie den Nagel schon auf den Kopf. Genau das ist eins der großen Probleme, unter dem wir leiden. Das ganze Wassermanagement, das wir normalerweise betreiben, ist ausgerichtet auf die Wasserversorgung für den Menschen. Wassersicherheit nennen wir das in dem Artikel. Dass Wasser in der Biosphäre aber auch als Lebensraum für Organismen eine große Rolle spielt, berührt uns traditionell höchstens sekundär, weil wir eben unser anthropozentrisches Weltbild haben und Wasser erst mal als Ressource für uns sehen. Was wir dabei immer bewusst oder unbewusst im Kopf haben: Wenn die Wasserqualität für uns gut ist, dann ist ein Gewässer auch für andere Organismen in Ordnung. Das ist aber nicht so.
Wasserqualität und Biodiversität - manchmal ein Widerspruch?
Denn wenn ich zum Beispiel einen Staudamm errichte oder ein Gewässer verbaue, dann kann die Wasserqualität chemisch und hygienisch gesehen einwandfrei sein, aber ich zerstöre oder verändere einen Lebensraum. Darunter leidet dann die Biodiversität.
Aber jemand, der rein an der Wasserversorgung für den Menschen interessiert ist, hat dann ja eigentlich nichts mit Fragen der Biodiversität am Hut.
Gessner: Da kommen wir jetzt zur philosophischen Frage, ob ich die Biodiversität erhalten sollte. Ich kann diese Frage vor dem Hintergrund stellen, ob die Biodiversität an sich auch einen Nutzen für den Menschen hat. Da gibt es inzwischen handfeste Hinweise, dass das tatsächlich so ist. Auch über offensichtliche Dinge wie die Fischerei hinaus. Das wäre ein Argument aus anthropozentrischer Perspektive, um nicht nur die Wasserqualität, sondern auch die Gewässer als Ökosysteme zu bewahren. Aber es gibt natürlich auch den ethischen Aspekt, dass auch andere Organismen ein Existenzrecht haben.
Ist das ethische Argument denn auch überzeugend in Regionen mit Wasserknappheit?
Gessner: Das ethische Argument gilt immer!
Virtuelles Wasser
Naja, aber wenn es um die Frage geht, dass vielleicht Menschen verdursten, wenn man auf den Staudamm verzichtet, dann wird man dem Wohl der Menschen sicher einen höheren Stellenwert einräumen.
Gessner: Der richtige Weg ist, dann nach alternativen Lösungen suchen. Wie kann ich beides unter einen Hut bekommen? Diese Frage wird viel zu wenig gestellt. Eine Möglichkeit bei lokaler Wasserknappheit besteht zum Beispiel darin, dass man Wasser in virtueller Form importiert. Das findet auch statt, ist aber in unserem Artikel nicht thematisiert. Global gibt es große virtuelle Wasserströme, weil wir internationalen Handel treiben, vor allem mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Industriegütern.
Mit virtuellem Wasser meinen Sie die Wassermengen, die gebraucht werden, um ein bestimmtes Produkt herzustellen, dem man das Wasser gar nicht mehr ansieht. Zum Beispiel ein Kilogramm Rindfleisch. Dazu muss ja zunächst ein Tier großgezogen werden, das Nahrung braucht. Und die Produktion der Tiernahrung verbraucht auch wieder Wasser.
Gessner: Genau, das ist virtuelles Wasser. So deckt zum Beispiel Israel zwei Drittel seines Wasserbedarfs im Land durch Lebensmittelimporte. Diese Zahl ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber die Größenordnung dürfte noch stimmen. Da können natürlich sehr große Wasserverschiebungen stattfinden, mit denen man lokale oder regionale Wasserprobleme lösen oder abmildern kann. Der Mensch selbst braucht ja nicht viel Wasser. Nur etwa fünf Liter pro Tag für den direkten persönlichen Bedarf – wenn Sie jetzt vom Verdursten sprechen.
Das bedeutet, in Sachen Wasserkonsum sollte sich die Welt möglichst intelligent über Handelsbeziehungen vernetzen. Damit die großen Wassermengen für Landwirtschaft und Industrie nur dort verbraucht werden, wo sie auch ausreichend zur Verfügung stehen. 2010 wollten Sie ja wissen, wo die Sicherheit des Wassers gefährdet ist. Sie sprechen da von verschiedenen „Stressoren“ wie Verschmutzung oder Stauanlagen, aber auch biotische Faktoren, die die Gewässerqualität beeinträchtigen. Ihre Karten umfassen ja die gesamte Erdkugel. War es da nicht schwer, an die Daten zu kommen und sie vergleichbar zu machen?
Gessner: Das war gerade die Herausforderung, und ich glaube auch der Grund, warum das Paper so positiv aufgenommen wurde. Weil wir erstmals versucht haben, die Bedrohung für Gewässer global zu erfassen. Aber was wir sehr schnell festgestellt haben: Dass es diese globalen Datensätze so gar nicht gibt. Das gilt insbesondere für die Biodiversität, wozu man kaum etwas findet. Da haben wir uns dann allein auf einige wenige Daten zu Fischen und zur Binnenfischerei stützten müssen.
Ich nehme an, die unterschiedlichen Datenquellen, die Sie hatten, waren ja auch nicht einheitlich geführt, oder? Zum Beispiel, wenn es um Chemikalien geht, die für bestimmte Gewässer erfasst sind.
Gessner: Nein, wir konnten meistens nicht einfach eine Datenbank abfragen und die Angaben direkt übernehmen, sondern wir hatten 23 verschiedene Datensätze und mussten für jeden Einzelfall mehr oder weniger intensiv überlegen, wie wir diese Daten im Sinne einer Bedrohung der Wassersicherheit oder Biodiversität zu interpretieren haben. Ursprünglich hatten wir mehr Material, aber einiges mussten wir verwerfen. Manche Daten hatten bessere Qualität, andere waren schlechter. Wir haben das Beste genommen, was zum damaligen Zeitpunkt verfügbar war.
Schaut man sich Ihre Karten an, dann brechen Sie die Bedrohung der Wassersicherheit oder der Biodiversität ja immer auf einen bestimmten Farbwert herunter. Ein sattes blau ist unproblematisch. Dann geht es über grün hin zu gelb und orange für kritische Regionen und ein rot dort, wo es besonders schlecht aussieht. Da wird manch ein Statistiker sicher skeptisch, wenn man unterschiedlichste Parameter wie chemische oder bakterielle Belastung mit der Staudammdichte vermengt und auf einen Farbwert herunterbricht.
Gessner: Da sind wir auch alle skeptisch, und diese Skepsis braucht man auch. Deswegen fand eine intensive Prüfung auf Plausibilität statt. Dazu finden Sie Informationen im Anhang des Papers. Was ich sehr bemerkenswert fand: Unabhängig davon, wie man die Basisdaten gewichtet, es war eigentlich egal – das Muster der weltweiten Verteilung änderte sich überhaupt nicht. Die Grundaussagen sollten also robust sein.
Was kam denn bei der Auswertung heraus? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Gefährdung des Wassers und der Biodiversität?
Gessner: Wenn Sie die Karten zur Wassersicherheit und zur Biodiversität vergleichen, sehen sie, dass die fast identisch sind. Das ist vielleicht erstmal überraschend. Aber sie bedeuten, dass beide Abschätzungen der Bedrohungen, nämlich für die Wassersicherheit und für die Biodiversität, das gleiche Resultat liefern in der räumlichen Verteilung. Und Sie stellen dort noch etwas fest, was ich fast das interessanteste Ergebnis finde: Dass viele Gegenden der Welt, wo wir davon ausgehen, die Wasserqualität sei ganz hervorragend, plötzlich rot eingefärbt sind. Zum Beispiel in Europa. Trotzdem haben Sie und ich ja keine Angst, Wasser aus dem Hahn zu trinken!
"Ich würde immer noch nicht überall baden"
Das verstehe ich nicht. Man liest doch immer wieder, wie sehr sich beispielsweise der Rhein erholt hat, und dass sich dort auch wieder Arten ansiedeln, die einmal ausgestorben waren.
Gessner: Im Vergleich zu früher ist der Rhein jetzt sauber, aber belastet ist er natürlich immer noch. Trotzdem, wenn sie an die Städte am Rhein gehen: Düsseldorf zum Beispiel nimmt Rheinuferfiltrat als Trinkwasser. Die Qualität ist hervorragend. Das liegt aber daran, dass wir die Technologien haben, um dieses Wasser aufzubereiten, und das sogar mit relativ wenig Aufwand. Die Arten, die wir heute im Rhein finden, sind übrigens überwiegend Fremdarten aus anderen Teilen der Welt. Mehr als 90 Prozent der wirbellosen Tiere zum Beispiel im Oberrhein unterhalb von Basel.
Aber auch die Wasserqualität vieler deutscher Gewässer gilt doch als hervorragend, so dass man sogar darin baden kann.
Gessner: Genau. Die Wasserqualität hat entscheidend zugenommen. Ich würde immer noch nicht überall baden, auch wenn man am Rhein teilweise wieder darüber nachdenkt. Es gelangen aber weiterhin Abwässer in die Flüsse. Zwar meistens gereinigt, aber immer noch Abwasser. Und wir haben es auch heute noch nicht im Griff, dass bei Starkregen die Kläranlagen überlastet sind. Bei solchen Ereignissen kommen dann regelmäßig enorme Mengen auch von ungereinigtem Abwasser in die Bäche und Flüsse. Damit hat man dann auch hygienische Probleme und chemische Belastungen. Und von Veränderungen der Gewässerstrukturen und der Hydrologie haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Also ist die Wassergefährdung, die man auf der ersten Karte sieht, nicht gleichbedeutend mit der Wasserqualität, die man sozusagen ‚unterm Strich’ erhält.
Gessner: Deshalb haben wir in einer weiteren Analyse auch die Wassertechnologie und das Wassermanagement mit einbezogen. Da kommen wir dann zu einer angepassten Karte, in die diese Faktoren mit eingerechnet sind. Dort sehen Sie jetzt, dass unser Gefühl, dass bei uns das Wasser in Ordnung ist, durch diese Karte auch wiedergegeben wird. Bereiche, die vorher im Osten der USA oder bei uns so rot waren, die sind jetzt plötzlich grün oder blau. Das bedeutet: Die Bedrohung ist da, auch aktuell. Wir belasten die Gewässer noch immer. Aber durch unsere Technologie kompensieren wir die Belastungen, so dass sie für die Wassersicherheit keine entscheidende Rolle mehr spielen.
Könnte man auch in technologisch weniger gut ausgestatteten Regionen die Wassersicherheit für die Bevölkerung erhöhen?
Gessner: Wir können nicht einfach die Technologien, die wir hier haben, auf alle anderen Teile der Welt übertragen. Bedenken Sie, dass wir in Deutschland fast 10.000 Kläranlagen haben, die unsere Abwässer reinigen. Dazu eine effiziente Trinkwasseraufbereitung und -verteilung. Das kann sich ein Land wie Indien in der Form nicht ohne weiteres leisten. Es gibt aber auch ganz simple Technologie für die Trinkwasseraufbereitung. Ich denke etwa an eine Methode, die Schweizer Kollegen vor mehr als 20 Jahren entwickelt haben. Die besteht einfach darin, Wasser in PET-Flaschen abzufüllen und diese in die Sonne zu legen. Nach einem Tag sind fast alle Keime abgetötet und die hygienischen Probleme gelöst.
Das klingt ja sehr banal!
Gessner: Ja, absolut banal, billig und fast überall durchführbar. Also eigentlich genial. Trotzdem gibt es Probleme bei der Umsetzung. Aus kulturellen, religiösen oder sozialen Gründen, die oft zu Schwierigkeiten führen, obwohl die Anwendung technisch oder finanziell überhaupt kein Problem wäre. PET-Flaschen finden Sie überall auf der Welt!
Da bräuchte man also einfach mehr Aufklärung?
Gessner: Aufklärung ist ein ganz wichtiges Element. Daran wird auch gearbeitet. Gefragt sind dann auch noch ganz andere Leute als Ingenieure oder Gewässerökologen. Die Probleme des rasanten Biodiversitätsverlusts in Gewässern bekommen wir allerdings auch mit solchen Technologien nicht in den Griff.
Interview: Mario Rembold
Letzte Änderungen: 30.08.2016